
22 Mrz Ich schreibe, also bin Ich – wörtliche Ausschweifungen
Schreiben über das Schreiben. Wie gern folge ich dem Aufruf von Anna Koschinski zur aktuellen Blogparade. Das bedeutet, viele, viele Blogschreiberlinge wie meinereine werden bis zum Ende dieses Monats ihre Ideen und Inspirationen zum Thema Schreiben veröffentlichen und über die Seite von Anna Koschinski bündeln. Was für ein Katalysator! Danke Anna, dass du diesen Raum schaffst und zur Verfügung stellst. Wir alle wissen: Wenn viele, einander wohlwollend, zusammenkommen, dann ist des Ergebnis so unermesslich viel mehr, als nur die Summe des Zusammengetragenen. Vielfalt! Hurra!
Die Erläuterung zur Bildwahl schreibe ich direkt, hier zu Beginn nieder: Alle Motive zeigen ein sogenanntes „Despacho“ oder „Haiwarykui“. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Tradition der Peruanischen Medizinleute, der Pacos und Curanderas. Speziell dieses Werkzeug fasziniert mich, denn ist ist wunderbarer Ausdruck, dass es keiner geschriebenen Worte bedarf, keiner formulierten Rechtschreibung und Grammatik, um eine Intention in die Welt zu bringen. Tradition, von einer Generation in die nächste weitergegeben. Ohne Rechtschreibreform. Immer im Einklang mit Mutter Natur.

Nahrhaft und nährend, Fülle und Pracht, jedem Anteil ein bestimmter Sinn innewohnend. Geschenk und Empfang. So oder so.
Ich schreibe, also bin ich
Natürlich ist es es nahezu vermessen, hier den ersten Grundsatz des Philosophen Renée Descartes für mich umzumünzen. Aber es passt. Haargenau. Ich möchte hier seine Begründung zitieren: „Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder phantasiert, selber nicht mehr zweifeln.“
Frei jeglichen Zweifels will ich jetzt vom Schreiben schreiben, von Musik und Dichtkunst, von Liedern und Gedichten, von Tonfolgen und Satzzeichen. Vor allem von dem Moment des Schöpfens. Allein das Wort „Schöpfen“ oder weitergeführt „die Schöpfung“ ist in unserem westlichen Kontext, geprägt durch die abrahamitischen Religionen, eigentlich nur dem einen, der so viele Namen trägt und doch die Namenlose Eine ist, andernorts Allmächtigen, irgendwo dort droben Wirkenden, Herrschenden, Richtenden, Verzeihenden, vorbehalten. Ich nenne sie die Weltenseele oder eben Schöpferkraft.
Und die steht uns allen zu, zur Verfügung, zur Seite.
Um es nicht direkt ins Allzuschwere gleiten zu lassen, möchte ich das Bild der Schöpfkelle wachrufen. Den Schöpfer in der Hand, aus dem Vollen schöpfen. Hat Schöpfen etwas mit Schopf zu tun? Wie oft habe ich mich mit dem eigenen Schreiben am Schopfe gepackt und somit aus dem Schlamm gezogen, meistens singend. Zum Schlamm komme ich im drittnächsten Abschnitt zurück.
Im Anfang war Musik
Auch mit dieser Überschrift wage ich wieder eine kühne Anlehnung. An nichts Geringeres als das Evangelium des Johannes, Kapitel 1. In einer Tradition, die auf der verschriftlichten Form des Wortes beruht, macht das Sinn. Unbedingt. Dass Maria unbefleckt übers Ohr empfängt, wie es auf vielen Gemälden dargestellt ist, ist die konsequente Weiterführung. Kurz zur Beschreibung. Der Erzengel Gabriel verkündet ihr die Frohe Botschaft und bläst diese in Form eines meist milchigen Tropfens per Lilienblasrohr ins Ohr. Zielsicher, fleckenfrei.

Zwar keine Lilie, aber weiß sind die Rosenblätter – hübsch befleckt mit Zuckerkonfetti! Leichtigkeit und Süße des Lebens
Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alle schöpfen – manchmal auch bis zur Erschöpfung. Genau genommen schöpfen, kreieren und gebären wir jeden Tag irgendetwas: eine Idee, ein Kind, ein Gemälde, ein Lied, einen Witz – mal mehr mal weniger froh.
Statt mich in immer feingliederigen weiten Wegen des heutigen Selbstverständnisses von Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbstoptimierung zu verlaufen, möchte ich mich auf das Verantwortungsbewusstsein im Großen & Ganzen, aber auch im Kleinen & Melodiösen fokussieren. Ich bin ein Teil des Ganzen, gerne bitte immer in meinem persönlichen Zentrum, an sich jedoch wohl einfach mitten drin in der schönen Welt.
Und es gibt da Etwas oder Etwer, das Größer ist, größer als ich ganz sicher. Das ist beruhigend und gut. Zurück zum Schöpfen: Schöpfen ist immer der Versuch, dem Chaos eine Struktur zu geben. Ganz frei nach dem Sinnspruch: no mud, no lotus
Da ist er, der vorhin bereits erwähnte Matsch, aus dem viel Schönes gedeihen, gezogen werden kann.

Buchstaben & Samen, Linsen & Schokolade – Keks und Blüte. Was brauch ich mehr?
In meinem allerersten Gedichtband „Lemonarien“ habe ich schon darüber poesiert. Und damit erklärt sich die Zentrums-Wahl des Titelbildes. Vor 14 Jahren fotografiert von Hajo Müller. 2011 beim Verlag kawe8 erschienen, war dies meine erste Buchveröffentlichung, quasi unbefleckt, eher gänzlich unerfahren und ganz frisch auf dem Weg, mich zurück in die Kraft des erzählenden, geschriebenen und gesungenen Wortes zu verlieben. Bis heute und wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage eine unverbrüchliche Liebesbeziehung. Allein der Titel eine Wortschöpfung: Lemonarien.
Es geht – im recht weiten Sinn – um das Tagebuch eines Zitronenkerns. Ums Pflanzen und Hegen, Gedeihen und Verderben, Wachstum und Abschied. Zitrone = Limone, Tagebuch = Diarium. Das macht zusammen im Plural: Lemonarien. Dass das Wort „Arie“ ebenfalls herausbringt, ist herzlich willkommene Begleiterscheinung. Selbstverständlich habe ich aus einigen Gedichten Lieder vertont.
Kraft des Schreibens und der Sprache
Sich etwas von der Seele schreiben. Etwas in die Seele schreiben. Jede, die Tagebuch schreibt, wird wissen, was ich meine. Allein durchs Niederschreiben kann man den inneren Zuständen Struktur geben, oder die Struktur im Geschriebenen erkennen. Von Hirn und Herz durch Hand und Stift oder Finger und Tastatur in Chiffren aufs Papier oder den Bildschirm verklausuliert UND jederzeit wieder abrufbar, quasi in Schrift geronnen. Wertgeschätzte Momente des eigenen Lebens mit Aufmerksamkeit bedacht.
Der folgende Sprung mag auf den ersten Blick gewaltig sein: ich reise in die Germanische Schöpfungsgeschichte.
Direkt zu Odin. Er ist wohl der Bedeutsamste im Germanischen Pantheon. Viele verbinden ihn mit kriegerischen Attributen, doch ist er auch und ebenso der Schutzpatron der Poesie & des Gesangs. Sehr gerne möchte ich hier die Expertin Alexa Szeli zitieren: „Der mächtige Gott Odin ist seit jeher ein ewig Suchender. Er ist süchtig nach der Weisheit des Lebens. Dieser große Gott ist also Geist, die Poesie, das Bewusstsein. Seine Brüder sind Wili, der Wille, und Wé, der heilige Raum.“
Was für ein wunderbares Bild: Du musst den Willen haben, zu schöpfen, musst aber auch gleichzeitig den passenden Rahmen dafür, also den heiligen Raum schaffen. Dann geschieht Schöpfung. Wortschöpfung, Komposition.
Und nebenbei: Odin war es auch, der die Runen entdeckte, ihre Sprache entzifferte. Diese geritzten Buchen-Stäbe, aus denen später unsere Buchstaben wurden – und noch viel mehr Zauber.

Hier eine Komposition aus noch mehr Buchstaben und Veilchenpastillen, Blätter vom Jiaogulan, dem Kraut der Unsterblichkeit – und die Lärchen zapfen zum Rosmarin
Da ich eine starke Befürworterin des andinen Grundsatzes von „Ayni“ bin, dass die Dinge nie nur in eine Richtung fließen, sei hier neben dem Germanischen auch gleich ein weiterer Gegenfluss knapp angerissen:
Abrakadabra
Wir alle kennen diesen Zauberspruch. Schon lange vor Harry Potter – und ich erwähne es an dieser Stelle gern: ich bin so große Verehrerin der Harry Potter Welt, besitze sogar einen Schlafanzug mit Hedwig-Motiven, aber das nur am Rande.
Zurück zur alten Zauberformel Abrakadabra. Die Erklärungen zum Hintergrund und zur Entstehung sind vielseitig. Bezugnehmend auf meinen Eingangs-Gedanken des Schöpferseins in der abrahamitischen Tradition finde ich es umwerfend stimmig, dass die hebräischen Worte „A-Bara ke-Dab’ra“ UND die aramäischen Worte „avrah k’davra“ beide gleichsam bedeuten: Ich werde erschaffen, während ich spreche.
Keine weiteren Fragen. Dabei möchte ich es für heute belassen.
Melodie von Sprache und Musik
Worte haben ein Bild und einen Klang. Es gibt Sprachen, da ist der Klang, die Modulation, von größerer Bedeutung als der Wortlaut. Allein die Tonhöhe. Die hier schreibende Schwäbin weiß, wovon sie schwätzt: „Awa“ kann je nach dem Erstaunen, Herablassung oder Ungläubigkeit zum Ausdruck bringen. Aber auch im chinesischen Mandarin verändert die Betonung den Sinn eines Wortes nicht unerheblich: „Ma“ mit einer gleichmäßigen Betonung bedeutet „Mutter“. Mit einer zunächst sinkenden und dann steigenden Betonung heißt „Pferd“. Und damit wäre ich wieder bei Odin und seinem Begleittier, dem achtbeinigen Pferd Sleipnir, mehr dazu bei Alexa Szeli. Um den Kreisel noch ein wenig kräftiger anzuschlagen: Wieviele Kekse sind auf dem ersten Despacho-Foto dieses Artikels zu sehen?
Damit komme ich zum melodiösen und musikalischen Teil zurück. Acht. Die Folge von acht Tönen bildet die Oktave. Das Grundsystem unserer westlichen Musiktheorie. Auf dieser Idee gründet sowohl Mozarts „Zauberflöte“ als auch Helene Fischers „Atemlos“.
Mir, die ich in einem musikalischen Haushalt in Süddeutschland aufgewachsen bin, liegt genau diese Tonalität, diese musikalische Tradition in den Genen. Im traditionellen Gehörgang meiner melodiösen Seelenverwandtschaft. Im Seelenausdruck meiner musikalischen Wahlverwandtschaft. Ich kann nicht OHNE.
Man hört mich, bevor ich zur Tür reinkomme. Weil ich summsinge. Immer. Unkontrolliert und unkontrollierbar. Da sind einfach immer Melodien in mir, die rauswollen. Wie ungezähmte Vögel.
Melodie und Wort, wenn die beiden verschmelzen, ist es günstigsten Falls wieder mehr als die Summe von beidem. Mal ist da zuerst die Melodie und dann wächst eine Geschichte dazu. Mal ist da ein Text und der Klang der Sprache webt es zum Lied.

Zur Tagundnachtgleiche. Im Einklang. Eine Lakritz-Schnecken-Entwicklung auf der Waage, Tag und Nacht, Mann und Frau, Du und Ich. Als Ganzes, was im Titelfoto noch zerteilt.
Schöpfung & Ich
Ja. Ich schreibe für mein Leben gern. Manchmal auch um mein Leben. Worte und Sprache dienen ja nicht nur der Übermittlung von Inhalten. Auch, schließlich leben wir hier in einer Tradition des geschriebenen Wortes. „Da hast du es schwarz auf weiß“, als Ausdruck unumstößlicher Wahrhaftigkeit. Aber sprechen wir noch mit der Schöpfung?
Wenn ich nun von Schöpfung & Ich, also mir schreibe, dann geht es unweigerlich auch um Verantwortung. Vorbei sind vielleicht die Zeiten, in denen Kunst um der Kunst willen alle Grenzen überschreiten durfte – und das ist nicht das Schlechteste. Ich weigere mich, alle Neuerungen und Änderungen primär als Einschnitt, Einengung oder gar Zensur zu betrachten. Wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine Tür auf, aber ich muss mich halt auch umdrehen, sonst sehe ich die andere Türe nicht.
„Sag es durch die Blume„ könnte so eine andere Türe sein. WAR eine dieser anderen Türen.
Anfang des 18. Jahrhunderts berichtete Lady Mary Wortley Montagu in ihren Briefen aus Istanbul von der „Kommunikation mit Blumen“. Im Orient stieß sie auf ein ausgeklügeltes System von Bedeutungen, die den einzelnen Blüten zukamen. Zur damaligen Zeit konnten insbesondere junge Liebende nicht klar aussprechen, was sie dachten, und Zuneigung und Abneigung verbal nicht klar Ausdruck verleihen. Die Blumensprache wurde daher zum wichtigen Mittel der nonverbalen Kommunikation.
So war es damals Brauch, dass Männer Damen einen Ansteckstrauß überreichten, wenn sie sie zum Ball einluden. Die Art und Weise, wie und wo die Damen den Strauß ansteckten, war ebenfalls mit Bedeutung versehen. Über dem Herzen drückte es Zuneigung aus, im Haar hingegen Ablehnung. Alles ohne Worte. Ohne Hassmails. Ohne Shitstorm.
Bevor es uns oder dem Gegenüber die Sprache verschlägt, lasst uns auch die wichtigen Dinge wieder öfter mal durch die Blume sagen. Ich wäre unbedingt für Fresien oder Schlüsselblumen, Ranunkeln oder Veilchen, gerne auch Narzissen. Die überreiche ich hiermit Anna Koschinski zum Dank für ihre Blogparaden-Einladung.
- Einen schönen Abschluss zum Thema „Schreiben & Blumen„, „Wort & Sang“, „Auf immer & ewig“ bildet die Tatsache, dass ich in dieser Woche erneut, und damit eben nach vierzehn Jahren wieder, mit dem Fotografen und Illustrator Hajo Müller Bilder für meine neue Homepage gemacht habe – im schönsten Blumenladen der Welt, der Blumenbar. Wunderbar.
Ich schreibe, also bin ICH schreibe mich um Kopf und Kragen. Könnte mindestens ein Lied davon singen. Alles zu seiner Zeit.
Abrakadabra. Simsalabim Bim. Dreimal schwarzer Kater.

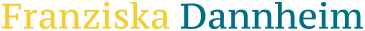
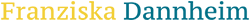

Sorry, the comment form is closed at this time.